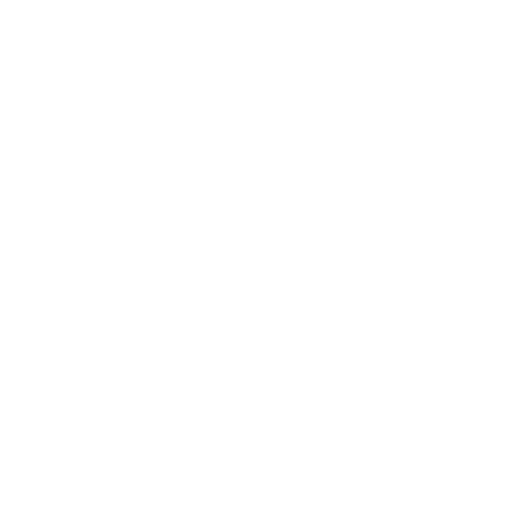Dieser Beitrag gehört zum Projekt „Inwertsetzung des immateriellen Kulturerbes im deutsch-slawischen Kontext“ (2019 – 2021), welches von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert wurde.
Größte Herausforderung der kleinen Heimatstuben und Museen sind ungeklärte finanzielle und (fach)personelle Ressourcen
Zum ersten Werkstattgespräch am 29. Juni 2020 trafen sich Vertreter*innen von Heimatstuben/ Museen des AK Lausitzer Museenland und Institutionen der Landkreise und der Sorben/ Wenden in direkter Nachbarschaft zum „Archiv verschwundener Orte“ in Horno/Rogow. Es war gleichzeitig der Testlauf für eine hybride Veranstaltung, wie sie unter den gegebenen Bedingungen erforderlich war, mit 21 anwesenden und sechs per Video zugeschalteten Teilnehmer*innen.
Im Fokus dieses ersten gemeinsamen Treffens stand die Bestandsaufnahme, die den Teilnehmenden in Form der „Ist-Analyse“ vorgelegt wurde. Offene Fragen, Kritik und Hinweise wurden rege diskutiert.
Eine anschließende Dialogrunde ging den Fragen nach „Bedeutung“ und „Zukunft“ der Heimatstuben/Museen nach. Den Bereichen Tradition, Identität und Bildung wurde große Bedeutung zugeschrieben. Insbesondere die Bildungsfunktion wurde ausführlich diskutiert.
Im Feld „Zukunft“ standen Profilentwicklung, strategisches Miteinander sowie zentrale Herausforderungen der Einrichtungen im Mittelpunkt. So wurden Fragen der dauerhaften Finanzierung (Forderung nach institutioneller Förderung) und der (fehlenden) Eigenanteile bei Projektförderungen ebenso erörtert wie die Folgen der begrenzten personellen Ressourcen und des Fachkräftemangels.
Begleitend zum Werkstattgespräch besichtigten die Teilnehmer*innen natürlich auch das „Archiv verschwundener Orte“.
Autor: Gregor Schneider
Linki w pśinosku | Links in diesem Beitrag
Transparenhinweis: Dieser Beitrag gehört zum Projekt „Inwertsetzung des immateriellen Kulturerbes im deutsch-slawischen Kontext“ (2019 – 2021). Dieses Projekt wurde vom Sorbischen Institut e.V, dem Heimatmuseum Dissen/Dešno und der Domowina Niederlausitz Projekt gGmbH durchgeführt und von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert sowie vom Brandenburgischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur unterstützt. Mehr dazu hier.